Jena, Germany
February 15, 2006
Quelle:
Max-Planck Gesellschaft
Als Antwort auf Schädlingsbefall
setzen Pflanzen flüchtige Duftstoffe frei. Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena sind jetzt
der Frage nachgegangen, wie ein Informationstransfer zwischen
benachbarten Pflanzen auf der Basis dieser chemischen Duftstoffe
funktionieren könnte. Aus Laboruntersuchungen gab es erste
Hinweise; allerdings spiegeln diese nicht unbedingt die
Freilandbedingungen wieder. Die Max-Planck-Forscher untersuchten
daher - u.a. auch im Feld - die Abwehrreaktion des Wilden Tabaks
(Nicotiana attenuata) auf Schädlingsbefall, nachdem er
Duftsignale einer eng benachbarten und verwundeten Pflanze,
nämlich des Wüstenbeifuß (Artemisia tridentata), empfangen
hatte. Sie fanden heraus, dass Tabakpflanzen im Vergleich zu
Artgenossen, die nicht die Gelegenheit hatten, am Wüstenbeifuß
zu "spionieren", besonders schnell und effizient ihre Schädlinge
abwehrten (Oecologia, Februar 2006). Dieses Phänomen wird
"Priming" genannt. Mithilfe gentechnisch veränderter Pflanzen
haben die Jenaer Wissenschaftler nun begonnen, die Duftstoffe zu
identifizieren, die diesen positiven Effekt auf die
Schädlingsabwehr der Nachbarpflanze haben.
|
 |
|
Abb. 1
Großer Lauschangriff: Wilder Tabak
(Nicotiana attenuata, im Vordergrund) belauscht die
Duftsignale des Wüstenbeifuß (Artemisia tridentata
tridentata). Beide Pflanzen sind natürliche Bewohner des
Great Basin Deserts in Utah, USA.
Bild: MPI für chemische Ökologie, Rayko
Halitschke |
Erstaunlicherweise verstärken die Tabakpflanzen ihre Abwehr erst
dann, wenn sie wirklich attackiert werden, und nicht unmittelbar
nachdem sie die Signale der verletzten Nachbarpflanze
wahrgenommen haben. Dieses Verhalten ist aus Sicht der Pflanze
sinnvoll: Wenn sie das Duftsignal alleine schon zum Anlass
nähme, ihre wertvollen Ressourcen in Abwehrmoleküle umzuwandeln,
wäre dies zu ihrem Nachteil, wenn sie am Ende doch nicht
befallen würde und trotzdem Energie in die Abwehr gesteckt
hätte. Zu den Abwehrsubstanzen gehören die so genannten
Proteinase-Inhibitoren (TPIs), welche die Verdauung
pflanzenfressender Raupen hemmen. Noch unbeantwortet ist die
Frage, inwieweit diese Kommunikation zwischen Tabak und Beifuß
eine Rolle in der Ökologie beider Arten spielen könnte.
Die Wissenschaftler vom Jenaer Max-Planck-Institut wollen nun
auch die Details des pflanzlichen Informationsaustausches
innerhalb einer Art aufklären. Ein erstes, interessantes
Resultat liegt bereits vor: Pflanzen des Wilden Tabaks (Nicotiana
attenuata) "riechen" und erkennen komplette Duftbouquets
ihrer Artgenossen, die aus verschiedenen gasförmigen Molekülen
bestehen [2]. Mithilfe einer gentechnisch veränderten Pflanze
(einer so genannten "stummen" Pflanze), die ausgewählte
Duftstoffe nicht mehr produzieren kann, wurde gezeigt, dass die
Zusammensetzung des Aromas sehr wesentlich ist. Durch das Fehlen
bestimmter Substanzen im Aroma der stummen, transgenen
"Senderpflanzen" reagierten die benachbarten Empfängerpflanzen
anders als wenn das Duftbouquet vollständig gewesen wäre.
Bei ihren Untersuchungen legen die Biologen großen Wert darauf,
Labor- und Freilanduntersuchungen zu kombinieren und
Laborversuche so "realistisch" wie möglich durchzuführen.
Üblicherweise werden Pflanzen im Labor für Duftanalysen in
relativ enge Glascontainer oder Kammern eingesperrt, was die
Konzentration von gasförmigen Molekülen künstlich erhöht.
Erschwerend kommt hinzu, dass Pflanzen - in den Gläsern
luftdicht eingeschlossen - schnell unter CO2-Mangel
leiden. "Um diesen Mangel zu kompensieren, öffnet die Pflanze
ihre Spaltöffnungen, durch die dann neben CO2 auch
mehr Duftmoleküle ins Blattinnere gelangen. Dadurch kann die
Reaktion der Empfängerpflanze künstlich verstärkt oder
verfälscht werden" erklärt Anja Paschold.
|
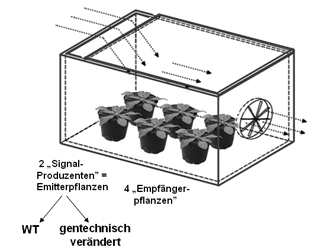 |
|
Abb. 2
Annäherung an natürliche Bedingungen
für Reihenuntersuchungen: Die kontinuierliche Versorgung
mit Frischluft (gestrichelte Pfeile) sorgt für den
Duftausstausch zwischen zwei Signalpflanzen und vier
Empfängerpflanzen. In letzteren werden die Reaktionen
auf die Duftmoleküle untersucht. Signalgeber sind sowohl
unveränderte als auch transgene, "stumme" Tabakpflanzen,
die bestimmte Duftmoleküle nicht synthetisieren können.
Bild: MPI für chemische
Ökologie, Anja Paschold |
Die
Wissenschaftlerin hatte in ihrer Arbeit [2] die
Duftkommunikation zwischen Tabakpflanzen einerseits unter
"realistischen" Bedingungen, andererseits mit Hilfe transgener
"stummer" Pflanzen untersucht (Abb. 2). Dabei fand sie heraus,
dass weder das vollständige Duftstoffprofil von Wildtyp-Pflanzen
noch das um einige Duftmoleküle beraubte Profil von gentechnisch
veränderten Pflanzen die schon bekannten Abwehrmechanismen in
Empfängerpflanzen beeinflusste: Nikotin-, Jasmonsäure- und
Proteinase-Inhibitor-Gehalte änderten sich kaum, und auch ein
"Priming"-Effekt konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings
ergaben Untersuchungen der Genexpression, dass deutlich mehr
Gene in der Empfängerpflanze reguliert waren, wenn dem
Duftstoffgemisch Blattalkohole und -aldehyde, die den bekannten
Duft des frisch gemähten Rasens erzeugen, fehlten. Wurde das
unvollständige Duftstoffbouquet wiederum durch synthetische
Blattalkohole und- aldehyde vervollständigt, waren die Gene
"unreguliert". Anscheinend werden also zumindest innerhalb einer
Art durch Duftsignale von Pflanze zu Pflanze bestimmte
Gen-Gruppen angeschaltet, andere dagegen abgeschaltet. Die
Funktion der meisten dieser Gene ist noch unklar und wird jetzt
analysiert.
Am Beispiel des Wilden Tabaks wollen die Wissenschaftler um Ian
Baldwin die "chemische Sprache", mit der sich Pflanzen
miteinander unterhalten, systematisch erforschen [3]. Neben den
"stummen" transgenen Senderpflanzen sollen auch "taube"
Empfängerpflanzen zum Einsatz kommen, die bestimmte Duftmoleküle
nicht mehr wahrnehmen können, weil ihnen der entsprechender
Rezeptor fehlt. Ohne die Methoden der Gentechnik wäre diese
spannende Grundlagenforschung nicht möglich.
Originalveröffentlichung:
[1] André Kessler, Rayko Halitschke, Celia
Diezel, Ian T. Baldwin
Priming of plant defense responses in nature by
airborne signaling between Artemisia tridentata and Nicotiana
attenuata
Oecologia, online first, DOI
10.1007/s00442-006-0365-8
[2] Anja Paschold, Rayko Halitschke, Ian T.
Baldwin
Using "mute" plants to translate volatile
signals
The Plant Journal 45, 275 - 291 (2006)
[3] Ian T. Baldwin, Rayko Halitschke, Anja
Paschold, Caroline C. von Dahl, Catherine A. Preston
Volatile signaling in plant-plant interactions:
"talking trees" in the genomics era
Science 311, 812 - 815 (2006)
Spying in the fields:
Using genetic engineering, researchers at the Max Planck
Institute have started to decipher the chemical vocabulary of
inter-plant communication
Translated by Mark Hucko,
Checkbiotech
As an
answer to an insect attack, plants release volatile scents.
Scientists at the Max-Planck Institute for Chemical Ecology in
Jena, Germany have been investigating chemical-scent exchange
between neighboring plants.
Preliminary laboratory research hinted at the first evidence,
however these lab results did not necessarily reflect field
conditions. Thus, the Max-Planck researchers have investigated
(with field trials as well) the defense reaction of the wild
tobacco plant (Nicotiana attenuate) to an insect pest attack,
after it had received scent-signals from a neighboring and
wounded plant - the Great Basin Sage Brush (Artemisia
tridentata).
They found that the tobacco plants that had the opportunity to
eavesdrop on the Great Basin Sage Brush, could quickly and
efficiently fight off the insects, when compared to other
tobacco plants which did not have this opportunity (Oecologia,
February 2006). This phenomena is called “priming.”
With the help of genetically modified plants, the Jena
scientists have started to identify the scents that allow
neighboring plants fight off an insect attack. With their
studies, the researchers were able to show that tobacco plants
were able to increase their defenses only after they had been
actually attacked, and not right after they had received the
signals from wounded, neighboring plants.
This behavior makes sense for the plant. If it had reacted to
the scent-signal to convert its valuable resources into
defense-molecules, this would put the plant at a disadvantage,
because it would have invested energy into defense mechanisms
that might not be needed since it had not actually been
attacked.
One of the defense-substances are the so-called
proteinase-inhibitors (TPIs), which hamper the digestion of
caterpillars. One question that remains to be answered is to
which extent does this communication between tobacco and sage
brush play a role in the ecology of both species.
Scientists at the Max-Planck Institute in Jena now want to
explain the details of inter-plant communication within one
single species. A first interesting result materialized, when
the researchers were able to demonstrate that wild tobacco
plants (Nicotiana attenuate) could “smell” and recognize the
entire scent-bouquet of other tobacco plants of the same
species. These scents are made up of various volatile chemicals.
With the help of genetically altered plants (or a so-called
“silent” plant), which could no longer produce selected scents,
the researchers showed that the scent composition is very
important. With the absence of certain substances in the scent
of the silent, “broadcasting” plants, the neighboring
receiver-plants reacted differently than if the scent-bouquet
were complete.
During their investigation the biologists made an effort to
combine laboratory and field experiments in order to make all
laboratory experiments as realistic as possible. Traditionally,
the plants were enclosed in relatively confined glass containers
during the scent-analysis in the laboratory. This artificially
increased the concentration of gas-forming molecules from the
plants. In addition, after the plants had been enclosed in these
glass containers, they suffered from CO2 deficiency.
“To compensate for this deficiency, the plant opens up its
stomata, through which CO2 and more scent-molecules
can pass into the interior of the plant. Due to this, the
receiver-plant’s reaction can be artificially amplified or
distorted,” explains Dr. Anja Paschold.
In her work, Dr. Paschold had researched the scent-communication
between tobacco plants under “realistic” conditions on the one
hand, and then she also used the help of “silent” transgenic
plants as a contrast. She found that neither the complete
scent-profile of wild-type plants, nor the partially reduced
profile of genetically engineered plants influenced the defense
mechanisms of the receiver-plants. She also noticed that
nicotine, jasmonic-acid, and proteinase inhibitors were
practically unchanged and that the priming effect could not be
determined.
However an analysis of the gene expression showed that clearly
more genes in the receiver-plants were turned on when the
scent-bouquet lacked leaf-alcohols and aldehydes, which for
example produce the well known scent of freshly mowed grass.
When the partial scent-bouquet again was complemented with
synthetic leaf-alcohols and leaf-aldehydes, then the genes were
turned off.
Apparently, at least in one species, various groups of genes
could be turned on and off as a result of inter-plant scent
signals. The function of the majority of these genes is not yet
clear, and is now being further investigated.
With the example of wild tobacco, the scientists under Dr. Ian
Baldwin’s direction want to eventually systematically research
the “chemical language” that plants use for communication.
Beside using “silent” broadcasting-plants, further tests will
look at “deaf” receiver-plants, which cannot recognize certain
scent molecules, because they lack the corresponding receptor.
The researchers note that this ground-breaking research would
not be possible without biotechnology.
© Max-Planck Gesellschaft |